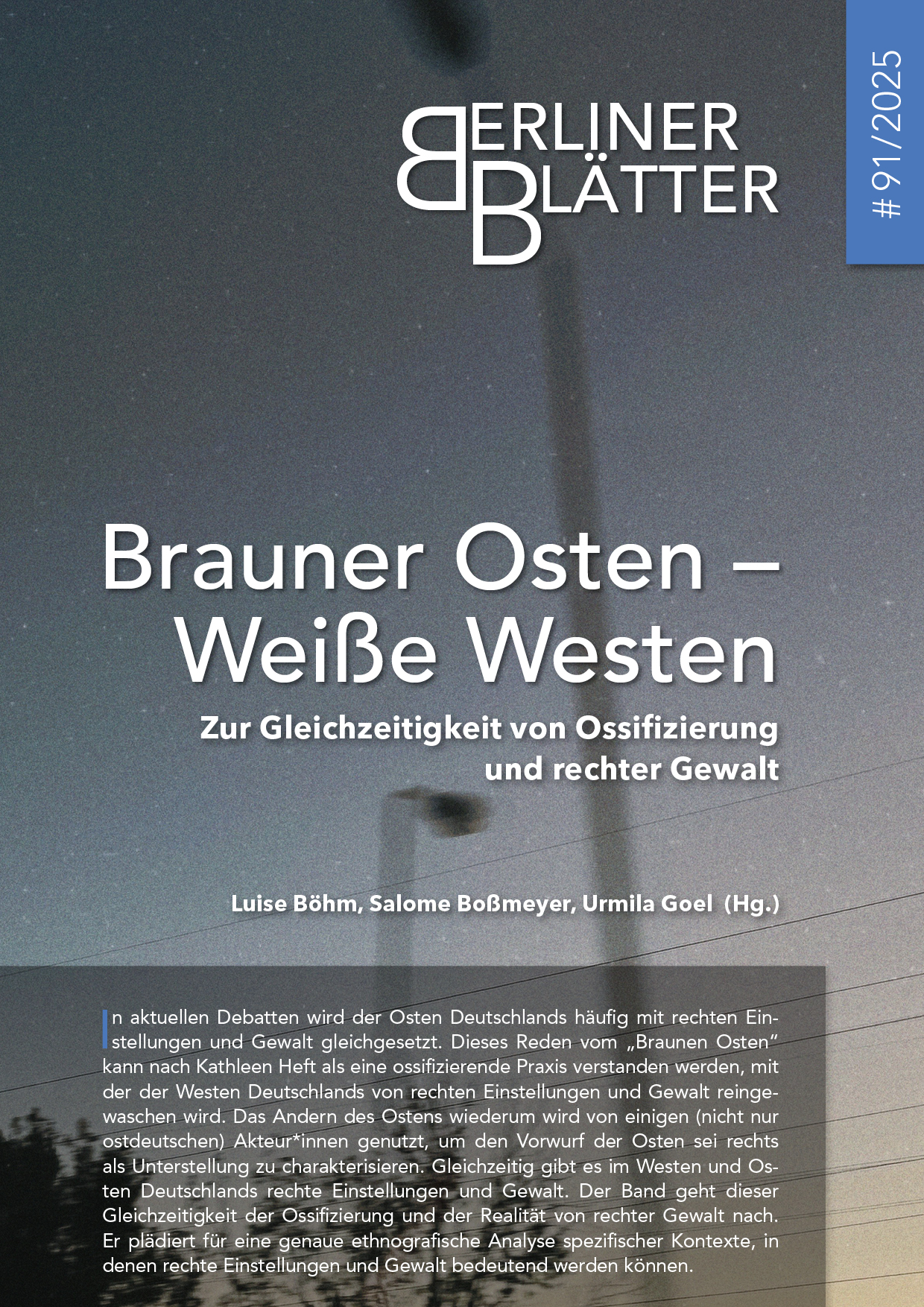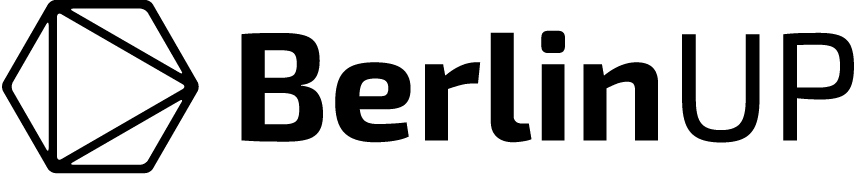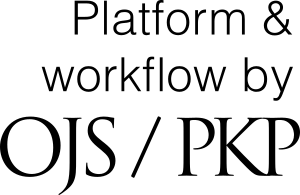Das Management of Hate als un/wirksame Externalisierungspraktik
DOI:
https://doi.org/10.60789/911190Schlagworte:
Management of Hate, Neue Rechte, Rassismus, Externalisiserung, Umgang mit RechtsextremismusAbstract
In diesem Beitrag beleuchte ich die Grenzen und Schwachstellen des Management of Hate (Shoshan 2016). Diese Regierungstechnik soll dafür sorgen, als NS-nah gelesene und somit als schlecht bewertete Nationalismen an den gesellschaftlichen Rand auszulagern und die Abgrenzung zu ihnen sicherzustellen. Ziel ist es, Deutschland als demokratische Gesellschaft zu repräsentieren, die sowohl frei von den Übeln der Vergangenheit als auch resistent gegen diese ist. Das darin transportierte Bild des ‚zu Rechten‘ korreliert jedoch nicht mit dem Aufschwung neuer rechter Gruppierungen in Deutschland seit 2015. Das erfordert neue Einordnungen, die ich hier als Perspektive der Kontinuität und Perspektive der Reaktion konzipiere. Mit der Perspektive der Kontinuität stellen neue rechte Gruppierungen und Akteure eine Neuauflage altbekannter ‚schlechter‘ Nationalismen dar, die ausgelagert und bekämpft werden müssen. Die Perspektive der Reaktion verortet dieselben Phänomene als notwendiges Korrektiv einer als ‚zu links‘ oder ‚zu liberal‘ wahrgenommenen gesellschaftlichen Entwicklung – und legitimiert sie damit als nicht ‚zu rechts‘. Trotz der gegensätzlichen Einordnungen verbindet diese Perspektiven eine Reihe an Gemeinsamkeiten, die schlussendlich Fallstricke in den Externalisierungspraktiken des Managements of Hate beleuchten: die Auslagerung von Unerwünschtem aus dem Eigenen und damit einhergehend die erschwerte Thematisierung von Diskriminierungsmechanismen als struktureller gesellschaftlicher Phänomene und nicht nur als Ideologie-Elemente innerhalb des ‚zu Rechten‘.
Downloads
Veröffentlicht
Zitationsvorschlag
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Salome Boßmeyer

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.